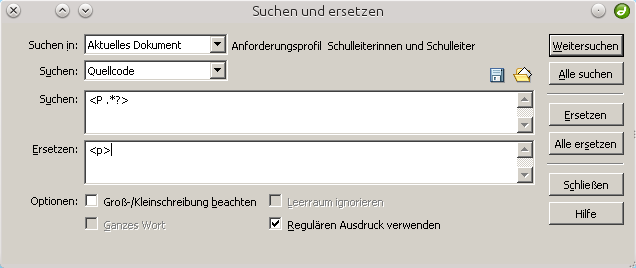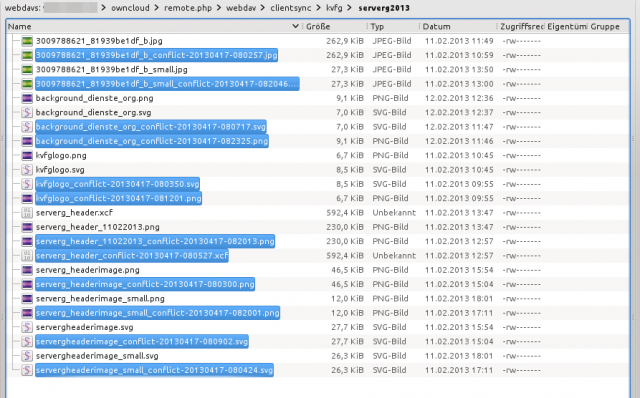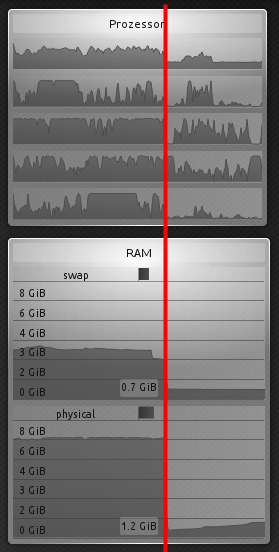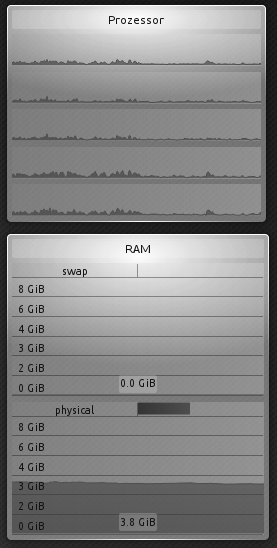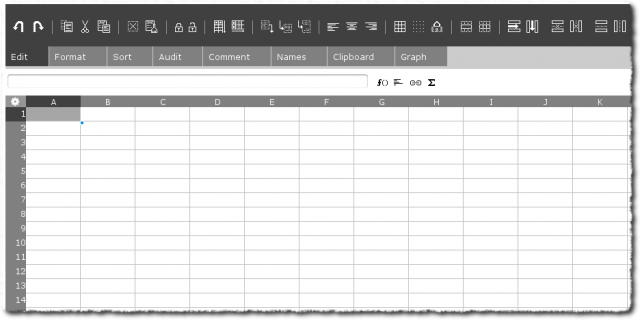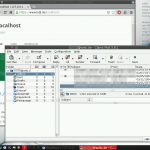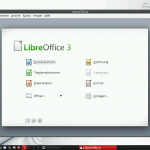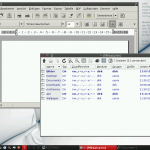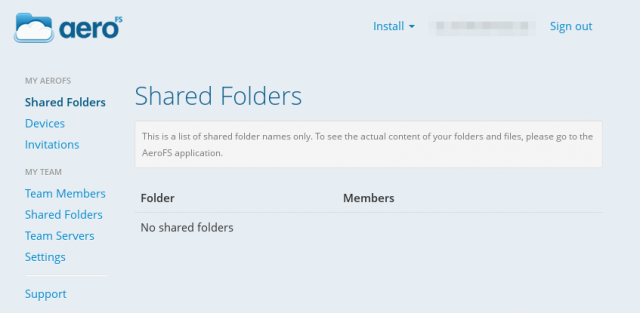Es kommt ja nicht so oft vor, dass man mehrere Tage auf der Comburg auf einer Fortbildung oder Tagung sitzt, aber wenn, dann muss man sich die Kaffemaschinentypen genau auswählen.
Dieser Maschinentyp ist (mindestens) in der Alten Abtei zu finden und könnte auch im Gebsattelbau oder anderen Gebäudeteilen auftreten.
Das Gerät erzeugt ein Gemisch aus frisch gemahlenen Bohnen und Wasser, das man nicht Kaffee nennen sollte. Selbst wenn man noch Milch dazu wählt, wird es nicht trinkbarer, was daran liegen mag, dass diese Maschine hierunter Milchpulver und noch mehr warmes Wasser versteht.
Ähnliche Typen von Warmwasserspendern sind auch an den Akademiestandorten in Bad-Wildbad (dort im Aufenthaltsraum oben) und in Esslingen (in der Eingangshalle – da dann allerdings ein großer Bruder von diesem Ding) zu finden – Bilder werde ich noch nachreichen.
Ein Heißgetränk aus derartigen Kisten kostet ab 1€ … und die sollte man sich sparen. Lieber den Weg in die Neue / Alte Dekanei antreten und dort eine der folgenden Maschinen nutzen:
Die große Kaffeemaschine in der Mensa in der Neuen Dekanei erzeugt trinkbaren Kaffee und sehr ordentlichen Latte Macchiato. Sie verfügt zwar über einen Knopf für „wenig Kaffee – viel Platz für Milch“, aber wenn man diesen drückt, wird die Tasse trotzdem bis zum Rand gefüllt. Will man also zum Frühstück lieber Milch-Kaffee trinken, sollte man gleich mit zwei Tassen antreten und diese beim Einlaufen austauschen.
Ein Latte Macchiato aus dieser Maschine kostet 2€ und ist sein Geld wert. Große Gläser sind entweder auf der Maschine zu finden oder hinter den Türen darunter, lange Löffel sind vorhanden und auch Schokoladenpulver zum Aufstreuen auf das Milchschaumhäubchen.
In der Alten Dekanei und damit hinter der Rezeption befindet sich die kleine Schwester der Mensa-Maschine. Außer Latte Macchiato habe ich hier noch nichts getrunken – aber dieser ist ordentlich. Qualität, Ausstattung und Kosten entsprechen also der Maschine im Speißesaal.